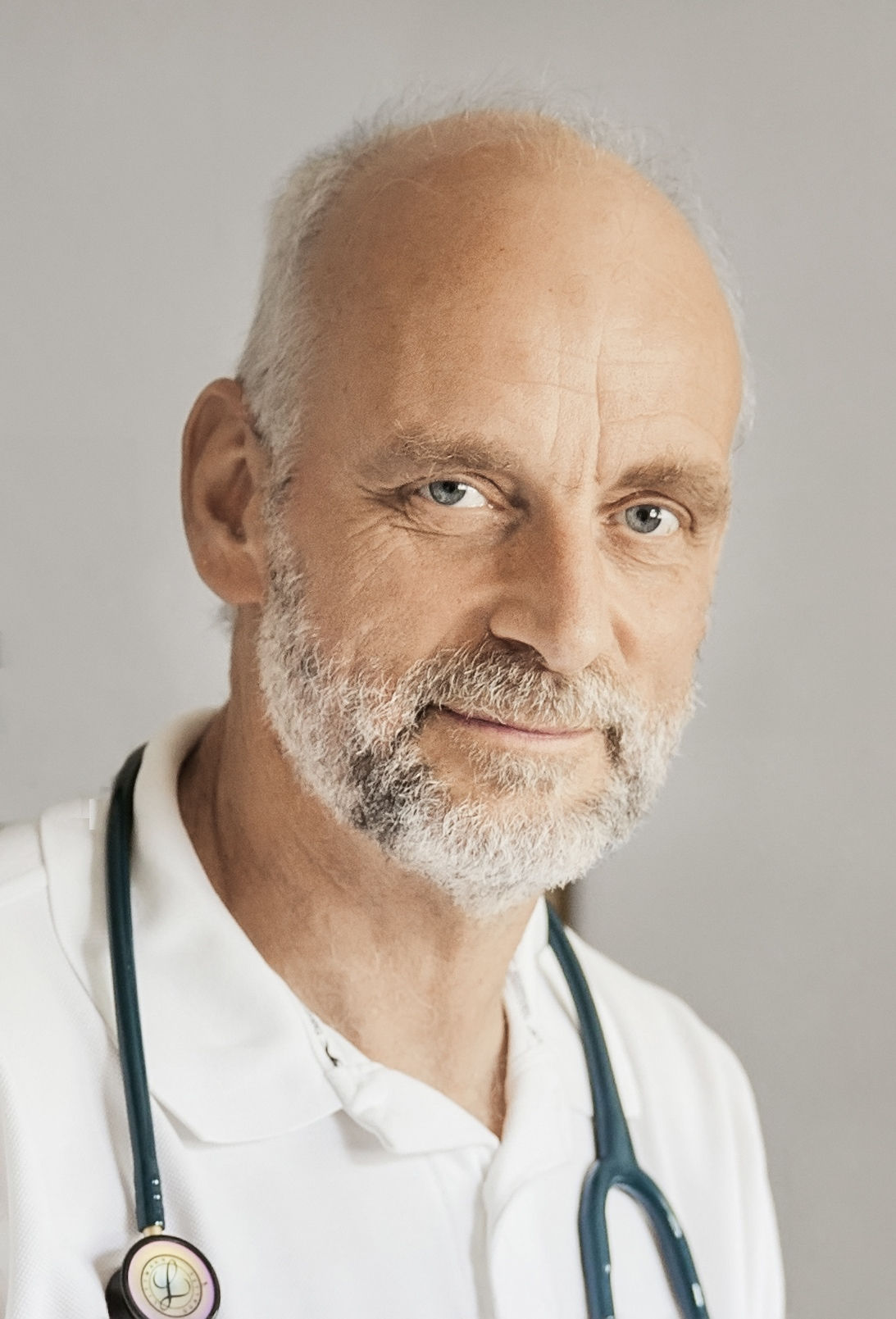Unser Leben, beruflich als Pädiater wie auch privat, hat Risse und Sprünge. Oft stehen wir gar vor einem Scherbenhaufen. Täglich erleben wir Verluste und Zerfall, zerbrochene Beziehungen, durch Krankheit und Tod zerfallenes Leben, Streit, Kampf, Ärger, Verdruss. Alles hinschmeißen, alles wegwerfen? Oder kann ich das alles für mein Leben wieder zusammensetzen?
»There is a crack, a crack in everything. That‘s how the light gets in.«
(Leonard Cohen, Anthem aus dem Album The Future, 1992)
Aus der japanischen Zen-Tradition stammt eine Technik, die sich Kintsugi, mit Gold flicken, nennt. Es ist eine traditionelle japanische Reparaturmethode für Scherben. Keramik- oder Porzellanbruchstücke werden mit dem aus dem Harz des Lackbaumes gewonnenen, Urushi genannten Lack wieder zusammengefügt und die Lücken mit Urushi-Kitt ergänzt. Der Lack und die Kittmasse können mit Gold-, Silber- oder Platinpulver versetzt werden, sodass ein edler, zufälliger Dekoeffekt entsteht, der das Objekt ästhetischer machen kann, als es zuvor in intaktem Zustand war, ein Upcyceln besonderer Qualität.
Was mit Kintsugi entstehen kann, ist Wabi-Sabi, eine Kombination aus verloren sein, Wabi, und Reife, Patina, Gebrauchsspuren zeigen: Sabi. Die Begriffskombination geht auf den im 16. Jahrhundert lebenden japanischen Tee-Meister und Zen-Mönch Sen no Rikyū (1522 – 1591) zurück. Die Denkweise war zuvor schon im japanischen Mittelalter weit verbreitet.

Die japanische Technik Kintsugi (mit Gold flicken)zeigt die Schönheit des Imperfekten. Auch im pädiatrischen Alltag muss nicht alles perfekt sein. Sorgen wir dafür, dass es auch "menscheln" darf, zum Wohl unserer Patienten!
Die Ästhetik, die sich mit Wabi-Sabi verbindet, ist die der Schönheit des Unvollendeten, des Imperfekten, des Gebrauchten, des Aufgegebenen. Die Verbreitung der "shabby chic"-Bewegung, der Reiz, den "lost places" jenseits von Funktionieren, Ordnung und Perfektion ausüben, sind Ausdruck dieses Schönheitsideals. Viele Dinge erleben wir heute im Zeitalter maschineller Serienfertigung als zu perfekt, zu glatt, und damit als kalt und gesichtslos. Ein paar Sprünge, Macken und Gebrauchsspuren machen Objekte lebendig.
Auch mit Mitmenschen mag es uns so gehen, Kanten und Ecken machen sie liebenswert und menschlich, Unnahbarkeit und kalte Glätte unsympathisch im Sinne des Wortes, man kann nicht mitschwingen, nicht mitleben, auch nicht mitleiden. Es ist das Knorrige, es sind die Brüche, die das Leben ausmachen: Nichts hat Bestand, nichts ist fertig und nichts ist perfekt. Das Leben ist eine Baustelle, eine Reise, und der Weg ist das Ziel.
Die japanische Wabi-Sabi-Ästhetik reicht von einer metaphysischen Basis über geistige Werte, moralische Vorschriften bis hin zur Materialisation, wie sie sich in der japanischen Teezeremonie manifestiert und in vielen Bereichen von Kunst und Kultur sichtbar wird.
Auf dieser Basis entstand Kintsugi als Begriff für das Zusammenfügen und Vergolden von Bruchstücken, von Fragmenten, wertlos erscheinender Scherben: zum Fehlerhaften, zu den Fehlstellen stehen, sie gar hervorheben und vergolden und damit neue, einmalige und unverwechselbare Werte zu erhalten und zu schaffen.
Tragen wir diese Erkenntnisse in den pädiatrischen Alltag, sodass wir auch in unserem Umfeld – Klinik wie Praxis – nicht immer perfekte, unangreifbare Edelstahl-kühle und Resopal-weiße Flächen brauchen. Sorgen wir dafür, dass es auch "menscheln" darf, wenn die Ästhetik bewahrt bleibt und ein Gestaltungswille durchschimmert. So wird aus dem Imperfekten die Kunst, die uns und den uns anvertrauten pädiatrischen Patienten mitsamt ihren Eltern beim Gesunden hilft.
|
|
Erschienen in: Kinderärztliche Praxis, 2025; 96 (4) Seite 240